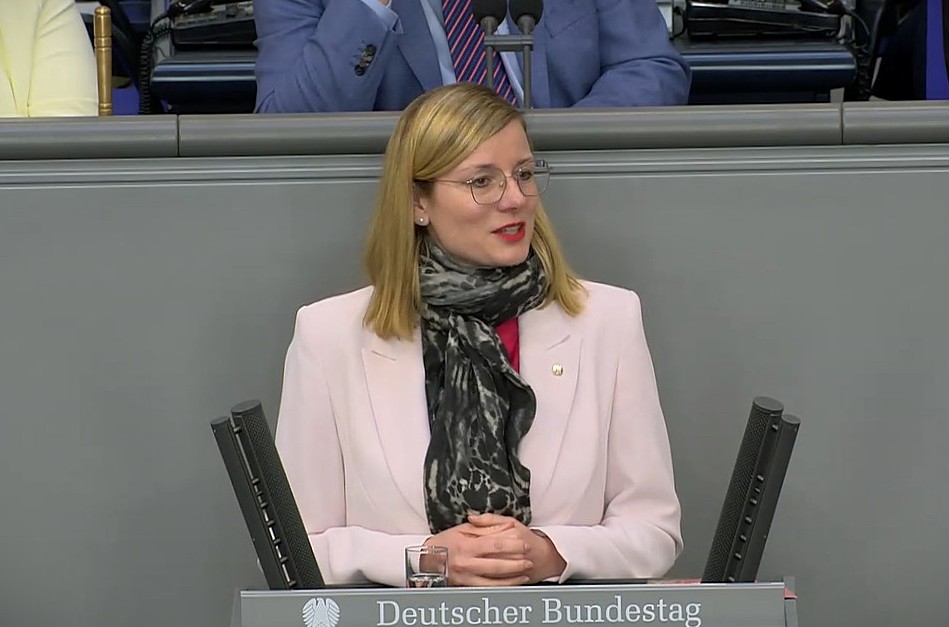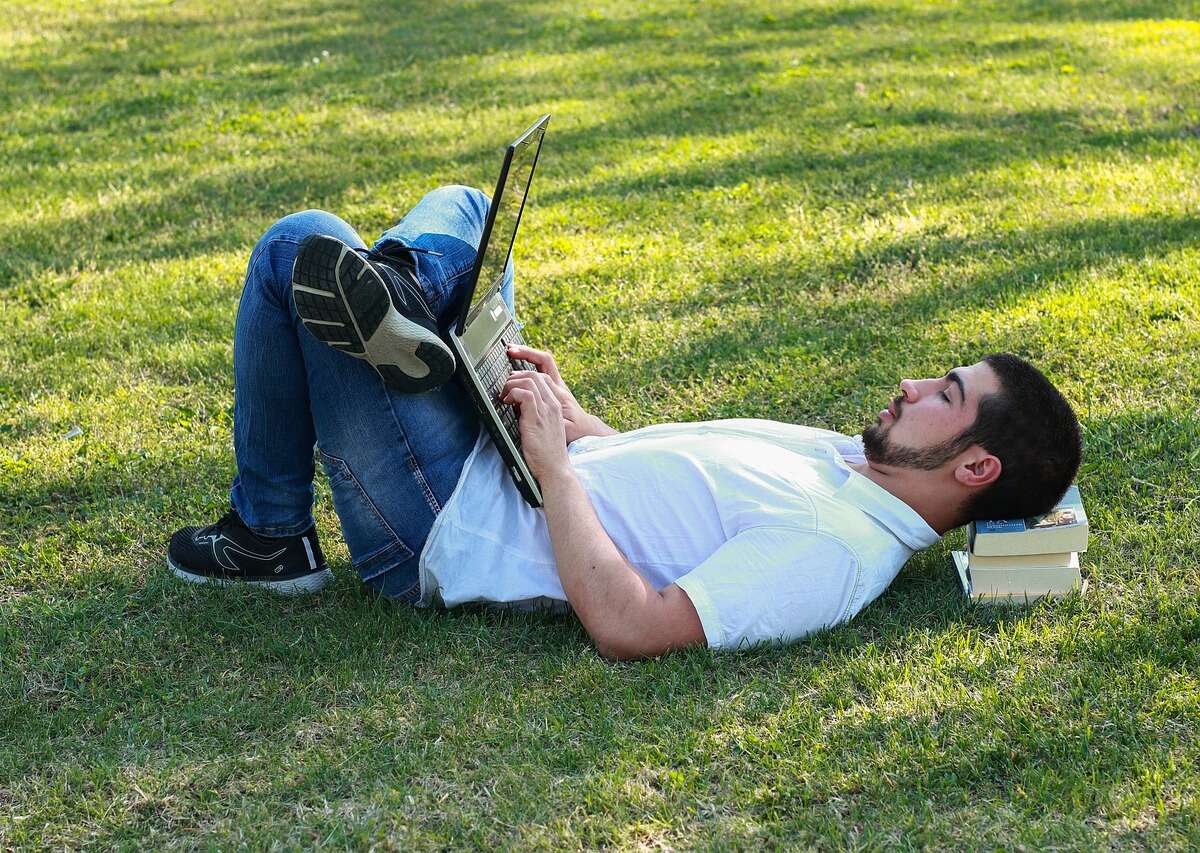Der Vorstoß kommt nicht unerwartet: Am 24. September hat die Europäische Kommission offiziell vorgeschlagen, das Gentechnikrecht der EU grundlegend zu verändern: Bestimmte gentechnisch veränderte Organismen (GVO) sollen von der bisherigen Risikoprüfung und Kennzeichnungspflicht ausgenommen werden. Sie bekommen zu diesem Zweck neue Namen wie “neue Genomtechniken”, „gezielte Mutagenese“ und „Cisgenese“ und bedürften keiner Gentechnik-Zulassung mehr. Vor drei Jahren hatte der Europäische Gerichtshof auch diese Produkte neuer Gentechnikverfahren wie CRISPR/Cas unmissverständlich als GVO eingestuft. Daraus zieht die EU-Kommission den Schluss, dann eben das Gesetz, nach dem das Gericht entschied, zu ändern. Die jetzt vorgeschlagenen Ausnahmen sind dabei nur der Anfang.
„Es gibt gute Gründe, dreißig Jahre nach ihrer Verabschiedung über eine Überprüfung der Zulassungsverfahren und Risikobewertungen von GVOs nachzudenken,“ kommentierte Benny Haerlin von „Save Our Seeds“, „der Vorstoß, der uns jetzt vorliegt ist allerdings weder wissenschaftlich durchdacht noch offen für Verbesserungen, sondern scheint ausschließlich dem Ziel zu dienen, Sicherheitsstandards zu senken und die Grundlagen der Sicherheitsphilosophie der Gentechnik-Richtlinie auszuhebeln. Statt umsichtiger Anpassung an die technische Entwicklung, geht es hier wohl nur um Anpassung an die Interessen der Gentech-Industrie.“ Indizien dafür sieht er in der einseitigen Interpretation von Aussagen der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA durch die Kommission und in einer wissenschaftlich nicht nachvollziehbaren Kasuistik, nach der die beabsichtigten Effekte bestimmter Genmanipulationen deren “Risikopfil” im Vergleich zu anderen Manipulationen substantiell schmälern.
Vereinfacht gesagt geht es etwa darum, dass in der Tat Mutationen einzelner Basenpaare in der DNA von Organismen in der Natur ständig vorkommen. Diese gezielt mit Hilfe eines eigens dafür geschaffenen und mit klassischen Gentech-Methoden in die Zelle eingepflanzten Such- und Schneidesystems (CRISPR/Cas) herbeizuführen und diesen Vorgang im Prinzip beliebig oft zu wiederholen, um die DNA nach dem eigenen Bauplan „umzuschreiben“, ist dagegen ganz offensichtlich kein natürlicher Vorgang mehr. Das Verfahren hat vielmehr ein enormes Potential für schnelle und weitgehende genetische Veränderungen mit erheblichen Auswirkungen. Als Innovationspotential wird dies von Wissenschaftler*innen, Biotechnolog*innen und Gentechnikunternehmen auch gerne betont.
Dass damit auch neue Risiken einhergehen, liegt auf der Hand. Dies gilt sowohl für beabsichtigte Effekte wie etwa die Produktion neuer Eiweisse und Inhaltsstoffe, toxische Effekte auf „Frassfeinde“ oder die Anpassung an neue ökologische Bedingungen (z.B. Hitze, Flut oder Dürre), die Konkurrenzvorteile schafft. Es gilt allerdings auch für eine breite Palette nicht beabsichtigter Effekte. Das beginnt damit, dass die gezielten Mutationen auch an anderen Stellen des Genoms stattfinden und dort unbemerkte Veränderungen verursachen können oder doch nicht ganz so gezielt steuerbar dafür aber auf andere Organismen übertragbar sind. Und es endet damit, dass die Einführung bestimmter Eigenschaften in ein Ökosystem gänzlich unvorhergesehene Konsequenzen in dem komplexen Zusammenspiel von Pflanzen, Mikroorganismen und Tieren haben kann. Für all diese Effekte gibt es wissenschaftlich gut dokumentierte Beispiele, die eine Risikoanalyse von Fall zu Fall und Schritt für Schritt angeraten erscheinen lassen. Dass bestimmte Risiken nur dann bestehen, wenn DNA aus einem fremden Organismus übertragen wird oder erst ab einer definierbaren Länge des veränderten DNA-Abschnittes ist dagegen nicht zu belegen.
Ein besonderer Vorschlag der EU-Kommission klingt auf den ersten Blick sehr sinnvoll: Bei künftigen Bewertungen sollten nicht nur die Risiken, sondern auch die Chancen für Nachhaltigkeit und Umwelt bewertet werden. Bei näherer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass dies nur auf bestimmte Technologien, nicht aber auf mögliche Alternativen bezogen werden soll und es im Wesentlichen ausreichen soll, mögliche Umweltvorteile anzuführen, ohne deren Realisierbarkeit, den Kontext und ein Vergleichbarkeit ermöglichendes Bewertungssystem geschehen soll. Nicht realisierte Versprechen etwa zur Reduzierung von Pestiziden (das Gegenteil war nachweisbar der Effekt) oder des Anbaus unter erschwerten Bedingungen pflastern seit über drei Jahrzehnten den Weg der Gentechnik in der Landwirtschaft, die bisher praktisch keines davon erfüllte. Es macht den an sich also begrüßenswerten Ansatz der Abschätzung von positiven wie negativen soziökonomischen und ökologischen Auswirkungen jenseits der klassischen Risikobewertung von vornherein unglaubwürdig, wenn er lediglich zur beschleunigten Einführung einzelner Technologien entwickelt und eingesetzt werden soll.
Der Vorschlag der Kommission kann als Aufschlag für die heisse Phase einer von Agarchemie-Konzernen und Technologie-Interessensgruppen seit Jahren vorbereiteten, neuen Auseinandersetzung um den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft und Umwelt und in Lebensmitteln verstanden werden. Sie wird sich möglicherweise über Jahre hinziehen. Bleibt zu hoffen, dass der bisher in diesem Bereich in Europa erfolgreich realisierte Vorsorge-Gedanke und: Einspruch Euer Ehren!