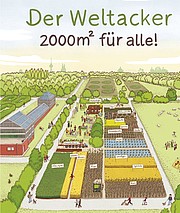News
07.09.2018 | permalink
Europäische Regionen fordern internationales Gentechnikregister

Damit keine gentechnisch veränderten Pflanzen oder Tiere unerkannt nach Europa importiert werden können, müssen diese eindeutig gekennzeichnet werden, fordert das europäische Netzwerk gentechnikfreier Regionen. Das gelte besonders für Organismen, die mit Genome Editing verändert wurden, heißt es in einer Deklaration, die heute in Berlin beschlossen wurde. Denn diese Technologien werden außerhalb Europas vielerorts nicht als Gentechnik eingestuft.
Anders als die deutsche Agrarministerin bekennt sich das Netzwerk, in dem die Regionalregierungen aus 64 europäischen Regionen vertreten sind, klar zur jüngsten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). „Das ist für uns ein wichtiger Meilenstein, mit dem klargestellt wird, dass auch die mit den neuen Gentechnikverfahren erzeugten Lebens- und Futtermittel einer umfassenden Risikobewertung, Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung unterliegen müssen“, sagte die hessische Umweltstaatssekretärin Beatrix Tappeser, seit 2017 Präsidentin des Netzwerks. Der EuGH hatte Technologien des Genome Editing wie CRISPR/Cas oder ODM, die Gene nur minimal verändern, im Juli rechtlich als Gentechnik eingestuft. Das bedeutet unter anderem, dass sie in Europa gekennzeichnet werden müssen.
Um sicherzustellen, dass solche gentechnisch veränderten Organismen (GVO) auch außerhalb Europas erkennbar sind, fordert das europäische Netzwerk ein öffentliches internationales Register aller weltweit freigesetzten GVO. Das bestehende Register des Biosafety Clearinghouse aus dem Cartagena Protokoll für die biologische Sicherheit sei ein geeigneter Rahmen für diese Aufgabe, heißt es in der Erklärung.
„Größte Vorbehalte“ haben die Mitglieder des Netzwerks gegenüber sogenannten „Gene drives“. Hier werden die Gene etwa eines Insekts so manipuliert, dass die Veränderung sich in einer Art Vererbungsturbo in kürzester Zeit in einer ganzen Population ausbreitet. Die Regionalregierungen fordern „alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Freisetzung von Gene drives in unsere Umwelt zu verhindern“. „Hier müssen Regelungen auch auf internationaler Ebene getroffen werden, da 'Gene drives' vor Ländergrenzen nicht Halt machen und die Auswirkungen auf Ökosysteme gravierend ausfallen können“, erläuterte Staatssekretärin Tappeser. Es sind also sowohl die Europäische Union als auch die internationale Staatengemeinschaft gefordert, ein Moratorium für Gene drives zu beschließen.
Schließlich sprechen sich die Regionalregierungen und internationalen Verbände, die bei der 9. Konferenz gentechnikfreier Regionen in Berlin ebenfalls anwesend waren, dafür aus, dass die genetische Vielfalt der Pflanzen und Tiere als eines der wertvollsten öffentlichen Güter der Menschheit erhalten und zugänglich bleibt. Dafür müsse der Staat verstärkt in landwirtschaftliche Forschung und Entwicklung investieren und so dazu beitragen, die agrarpolitischen Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. [vef]
06.09.2018 | permalink
Klöckner: neues Gesetz für Genome Editing?

Bundesagrarministerin Julia Klöckner ist mit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), die Technologien des Genome Editing als Gentechnik zu werten, offenbar nicht einverstanden. „Die klassische grüne Gentechnik mit CRISPR/Cas in einen Topf zu werfen, halte ich für sachlich falsch”, sagte die CDU-Politikerin gestern der Nachrichtenagentur Reuters. Ob es zu Gesetzesänderungen komme, werde man sehen.
Wie berichtet hatte der EuGH im Juli entschieden, dass neue Gentechnikverfahren wie CRISPR/Cas oder ODM rechtlich wie Gentechnik zu behandeln sind. So hergestellte Organismen müssen also auf ihre Risiken geprüft und zugelassen werden. Das Gericht berief sich vor allem auf das Vorsorgeprinzip und folgte damit der Argumentation der Gentechnikkritiker – sehr zum Entsetzen von Industrie und großen Teilen der Wissenschaft. Entsprechend harsch war die Urteilsschelte.
Da der EuGH in dieser Frage jedoch die letzte Instanz ist, ist dieses Urteil unanfechtbar rechtsgültig. Will jemand an der Rechtslage etwas ändern, bleibt in der gewaltengeteilten Demokratie nur der Weg über die Gesetzgebung – in diesem Fall auf EU-Ebene. Eine Petition gegen die EuGH-Entscheidung, wie sie ein französischer Wissenschaftler jetzt auf den Weg gebracht hat, kann den Richterspruch nicht mehr rückgängig machen.
Auch Frau Klöckner hatte wohl schon im Juli Plan B im Auge. Sie wolle „den Blick für Entwicklungen und Innovationen offenhalten“, teilte die Agrarministerin wenige Stunden nach dem EuGH-Urteil mit. „Diese Diskussion möchte ich in Europa gemeinsamen mit der Europäischen Kommission und den Mitgliedsstaaten vorantreiben.“ “Wir müssen achtgeben, dass wir nicht aus Luxuspositionen des Überflusses heraus in Europa eine neue Technologie vor die Tür setzen”, ergänzte sie jetzt laut Reuters. Die neue Technologie könne die Lösung für landwirtschaftliche Probleme werden. Als Beispiel nannte sie dürre-resistente Pflanzen, die von den Befürwortern der Gentechnik schon seit Jahren angekündigt werden. Faktisch setzte die Agrarindustrie die Gentechnik jedoch vor allem dafür ein, Pflanzen gegen die von ihr hergestellten Pestizide resistent zu machen.
Eine klare Vorstellung hat die Agrarministerin vom Ablauf der Diskussion: “Wir müssen eine Debatte führen, die wissenschaftsbasiert ist und nicht nach Stimmungen geht”, wird sie von Reuters zitiert. Hatten wir das nicht schon mal irgendwo gehört? Ein Blick in die Rede von Bayer-Chef Werner Baumann bei der Hauptversammlung des Chemiekonzerns im Mai hilft weiter: Die Politik dürfe „nicht nur auf das schauen, was heute den Vorstellungen und Umfragen entspricht“, gab der Konzernlenker vor. Wichtig sei, „was morgen und übermorgen gesellschaftlichen Fortschritt und wirtschaftlichen Wohlstand verspricht“. Kein Risiko einzugehen sei für die Gesellschaft keine Option, so Baumann.
Bei der Diskussion des Themas mit ihrem Koalitionspartner SPD steht Klöckner offenbar noch ganz am Anfang: “Neue Gentechnikverfahren, wie die Genschere CRISPR/Cas und die damit erzeugten Produkte, unterliegen dem Gentechnikrecht”, versicherte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Matthias Miersch, heute gegenüber Reuters. „Das Urteil des EuGH sollte auch die Bundeslandwirtschaftsministerin anerkennen.” Miersch forderte Klöckner auf, unverzüglich einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen grundsätzlich untersagt werde
Heftige Kritik kommt von der Opposition: Die Agrarministerin stimme „nach kürzester Schamfrist voll ein in den Chor der Gentechnik-Lobby, der sich seit dem Gentechnik-Urteil überschlägt in schriller Richterschelte und Forderungen nach Gesetzesänderungen“, schimpft der Gentechnikexperte der Grünen, Harald Ebner. Wenn sie in Frage stelle, dass auch die neue Gentechnik Gentechnik ist, ebne sie den Weg für Verbrauchertäuschung durch verschleierte Gentechnik im Essen. [vef]
- Reuters: Klöckner will gegen Einschränkungen neuer Gentechnik angehen (5.9.2018)
- Reuters: SPD und Grüne kritisieren Klöckners Gentechnik-Vorstoß (6.9.2018)
- Die Bundeslandwirtschaftsministerin zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu den neuen molekularbiologischen Züchtungstechniken (25.07.2018)
- Bayer-Webseite: Rede von Werner Baumann, Vorsitzender des Vorstands der Bayer AG (25.5.2018)
- Infodienst - Der EuGH stellt klar: Gen-Scheren sind Gentechnik (25.07.2018)
03.09.2018 | permalink
Medien kritisieren Förderung einer neuen Fachstelle Gentechnik

Das Bundesumweltministerium fördert eine Fachstelle Gentechnik und Umwelt (FGU) für zweieinhalb Jahre mit insgesamt 200.000 Euro. Die FDP und einige Medien haben diese Förderung in den vergangenen Wochen angegriffen und der Fachstelle Voreingenommenheit unterstellt. Der Grund: Der gentechnikkritische Verein Testbiotech in München ist Träger des Projekts.
Testbiotech wurde vor zehn Jahren als „Institut zur unabhängigen Folgenabschätzung im Bereich der Biotechnologie“ gegründet. Der Verein hat sich mit seinen kritischen und wissenschaftlich belegten Stellungnahmen intensiv und erfolgreich in die öffentliche Debatte um die Agro-Gentechnik in Deutschland und der Europäischen Union eingemischt. Befürwortern der Agro-Gentechnik sind die Organisation und ihr Geschäftsführer, der frühere Greenpeace-Campaigner Christoph Then, deshalb ein Dorn im Auge.
2017 beantragte Testbiotech beim Bundesamt für Naturschutz (BfN) eine Zuwendung, um eine Fachstelle Gentechnik und Umwelt einzurichten. Ziel sei „die Förderung einer informierten gesellschaftlichen Diskussion auf der Basis aktueller Informationen und wissenschaftlich verlässlicher Analysen“, heißt es im Antrag. Festgelegt würden die Inhalte von Non-Profit-Organisationen, „die sich unter der Perspektive des Vorsorgeprinzips mit dem Thema befassen, ohne eigene ökonomische Interessen an der Verwertung der Technologie zu haben.“ Dazu sind sieben Organisationen in einem Beirat vertreten, darunter der Umweltverband BUND, die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) und Save our Seeds.
Das BfN gewährte wie beantragt gut 200.000 Euro für den Zeitraum von Anfang Oktober 2017 bis Ende Februar 2020. Mit dem Großteil der Mittel wird eine Wissenschaftlerstelle finanziert, die öffentlich ausgeschrieben und mit einer promovierten Biologin besetzt wurde. Ihre Doktorarbeit schrieb sie über epigenetische Modifikationen in der Fruchtfliege und sammelte dabei praktische Erfahrungen mit neuen gentechnischen Verfahren wie CRISPR/Cas. Die Zuwendung stammt aus dem Umweltforschungsplan des Bundesumweltministeriums. Aus diesem Topf fördert das Ministerium Projekte und Forschungsvorhaben in allen umweltrelevanten Bereichen, vom Klimaschutz über Luftreinhaltung bis zu nachhaltiger Mobilität. Insgesamt standen dafür 2017 rund 57 Millionen Euro zur Verfügung.
Beim Thema Gentechnik entscheidet über die Vergabe das BfN, das mögliche Auswirkungen der Agro-Gentechnik und neuer gentechnischer Verfahren auf Umwelt und Natur fachlich beurteilt. Im Umweltforschungsplan macht dieser Bereich nur ein winziges Kapitel aus. Denn Gentechnik und Biotechnologie fallen ansonsten in die Kompetenz des Landwirtschafts- und des Forschungsministeriums. So gab das Forschungsministerium 2017 sechs Millionen Euro frei, um zwei Jahre lang „Nutzpflanzen der Zukunft“ zu fördern, die mit Hilfe neuer gentechnischer Verfahren hergestellt werden sollen. Aktuell fördert das Ministerium auch Projekte zur Genom-Editierung von Äpfeln und Sojabohnen.
Auslöser der Kritik an der Fachstelle Gentechnik und Umwelt war eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Diese steht in einer Reihe von Anfragen, mit denen die Freien Demokraten offenbar thematisieren wollen, dass die Bundesregierung Verbände und Organisationen aus dem Umweltbereich unterstützt. Gegenstand dieser Anfragen sind unter anderem der Naturschutzbund Deutschland, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Greenpeace, die Deutsche Umwelthilfe und die Denkfabrik Agora Energiewende. Die Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage zur Fachstelle nahmen Medien wie Süddeutsche Zeitung und Spiegel zum Anlass für Artikel. Deren Tenor: Der Bund finanziere mit Steuergeldern eine gentechnikkritische Lobbyorganisation.
In seiner Reaktion wies Testbiotech darauf hin, dass die Journalistinnen dem Verein in beiden Fällen nicht Gelegenheit gegeben hatten, zu der Kritik Stellung zu nehmen. Deutlich wies die Organisation den Vorwurf zurück, unwissenschaftlich zu arbeiten: „Testbiotech legt Wert darauf, nach wissenschaftlichen Standards zu arbeiten und gleichzeitig unabhängig von den Interessen derer zu sein, die von Anwendungen der Gentechnik profitieren“, heißt es in der Stellungnahme. Und weiter: „Im Vordergrund unserer Arbeit steht die Perspektive des Umwelt- und Verbraucherschutzes.“ Dies rechtfertige es jedoch nicht, Testbiotech als Lobby-Organisation oder Technikfeinde zu bezeichnen.
In der Antwort der Bundesregierung an die FDP steht auch, dass unterschiedliche Projekte gefördert würden, „die den öffentlichen Dialog zu den Entwicklungen in der Biotechnologie und Gentechnik unterstützen sollen.“ Genannt wird explizit das Forschungsprojekt „Ethische, rechtliche und sozioökonomische Aspekte der Genom-Editierung in der Agrarwirtschaft“ (Dialog GEA). Dessen Träger ist das Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie, dessen Direktor Ralph Bock ein entschiedener Befürworter der Agro-Gentechnik und des Einsatzes neuer gentechnischer Verfahren ist. Fördersumme: mehr als eine Million Euro, verteilt auf drei Jahre. [lf]
- Testbiotech: Neue wissenschaftliche Fachstelle für Gentechnik und Umwelt (22.05.2018)
- Süddeutsche Zeitung: Bund finanziert Ökolobby (17.08.2018)
- Testbiotech: Wo bleibt die journalistische Ausgewogenheit, liebe Süddeutsche Zeitung? (17.08.2018)
- Spiegel online: Bund spendiert Gentechnik-Gegnern 200.000 Euro (20.08.2018)
- testbiotech: Einseitige Berichterstattung bei Spiegel Online - Bundesregierung beantwortet kleine Anfrage der FDP (21.8.2018)
- Die Anfrage FDP zur Fachstelle Gentechnik und Umwelt und die Antwort der Bundesregierung (13.08.2018)
- Bundeshaushaltsplan 2017, Einzelplan 16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
- Umweltforschungsplan 2018-08-29
- Zur Finanzierung von ELSA-GEA - Ethische, Rechtliche und Sozioökonomische Aspekte von Genom-Editierung in der Agrarwirtschaft
31.08.2018 | permalink
Bioökonomierat fordert neues Gentechnikrecht

UPDATE +++ Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu den neuen gentechnischen Verfahren hat der Bioökonomierat die Politik aufgefordert, das Gentechnikrecht zu ändern. Wenn Pflanzen und Tiere, die mit Genome-Editing-Technologien manipuliert wurden, zeitaufwendig nach EU-Recht zugelassen werden müssten, verliere Deutschland den Anschluss an die internationale Entwicklung, meint das Beratergremium der Bundesregierung.
Doch auch die 17 Mitglieder des Rats sehen bei einer zu rasanten unkontrollierten Ausbreitung derart gentechnisch veränderter Organismen (GVO) Risiken. Daher sollte die Bundesregierung ihrer Ansicht nach solche GVO auch nicht komplett freigeben. Wichtig sei eine Regulierung, die zwischen Mutationen und Gentransfers unterscheide und risikoorientierte Verfahren für die Zulassung und Freisetzung vorsehe, sagt Christine Lang, Ko-Vorsitzende des Bioökonomierats und Mitgründerin der Berliner Biotech-Firma Organobalance.
Der 2009 gegründete Bioökonomierat, in dem ExpertInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft vertreten sind, plädiert für ein abgestuftes Genehmigungs- und Zulassungsverfahren mit unterschiedlichen Risikoklassen. Ferner spricht der Rat sich dafür aus, es behördlich zu registrieren und zu beobachten, wenn Wissenschaftler oder Unternehmen Genome-Editing-Technologien einsetzen. Die aktuelle Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Organismen lässt sich nach Ansicht des Gremiums nur aufrechterhalten, wenn sie sich auf größere, artfremde Genomveränderungen beschränkt. Bei winzigen sogenannten Punkmutationen sei eine Kennzeichnung im internationalen Warenverkehr nicht praktikabel. Der Rat empfiehlt daher, die Infrastruktur für freiwillige Zertifizierungen zu stärken, um Verbrauchern die Wahl zu lassen, sich für gentechnikfreie Lebensmittel zu entscheiden.
Bei gesellschaftlich besonders relevante Anwendungen der neuen Technologien müsse die Forschung stärker öffentlich gefördert werden, fordert das Gremium unter Vorsitz von Professor Joachim von Braun, Direktor des Zentrums für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn. Begleitend müssten die Auswirkungen auf die Artenvielfalt sowie auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen mithilfe öffentlicher Gelder wissenschaftlich untersucht werden. Schließlich wünschen sich die Berater neue Dialogformate für einen konstruktiven Diskurs mit der Gesellschaft und eine bessere internationale Zusammenarbeit.
Ziel des Bioökonomierats ist laut Webseite, positive Rahmenbedingungen für eine biobasierte Wirtschaft zu schaffen, sowie Forschung und Entwicklung in der Bioökonomie zu fördern. Bei seiner Arbeit wird das ehrenamtliche Beratergremium von einer Geschäftsstelle unterstützt, die das Bundesforschungsministerium nach Angaben einer Sprecherin seit 1.12.2008 mit insgesamt 6,83 Millionen Euro gefördert hat. Aufgabe der Geschäftsstelle sei die fachliche und administrative Betreuung und Unterstützung des Bioökonomierats. Dazu gehöre auch, Vorträge vorzubereiten. Außerdem enthalte das Budget mögliche Reisekosten der Ratsmitglieder, die nach Bundesreisekostengesetz erstattet würden. [vef]
Update: Fördersumme des Bundesforschungsministeriums
20.08.2018 | permalink
Behörde: Cibus-Raps doch gentechnisch verändert

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu den neuen gentechnischen Verfahren sind die herbizidresistenten Rapslinien der kanadischen Firma Cibus als gentechnisch verändert einzustufen. Zu diesem Ergebnis kam das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) nach erneuter Prüfung und nahm seinen anderslautenden Bescheid aus dem Jahr 2015 zurück.
Am 5. Februar 2015 hatte das BVL auf Antrag der Firma Cibus festgestellt, die mit Hilfe des Rapid Trait Development Systems erzeugten herbizidresistenten Rapslinien seien keine gentechnisch veränderten Organismen im Sinne des Gentechnikgesetzes. Das hätte bedeutet, dass der GV-Raps unkontrolliert hätte angebaut werden dürfen. Um das zu verhindern und sicherzustellen, dass der Cibus-Raps nicht konventionelle Sorten verunreinigen kann, klagten eine konventionelle Ölmühle, ein biologischer Saatgutzüchter und der Bund für Umwelt- und Naturschutz BUND gegen diesen Bescheid. Damit durfte der Cibus-Raps vorläufig nicht auf deutsche Äcker. „Viele Kulturarten, an denen gentechnisch verändert wird, sind auskreuzungsfähig“, erläuterte Gebhard Rossmanith, Vorstandsvorsitzender der klagenden Bingenheimer Saatgut AG. „Raps ist besonders problematisch, weil es viele andere Kreuzblütler bei Nutzpflanzen wie Kohl, Broccoli etc. sowie bei Wildpflanzen gibt. Einer so auskreuzungsfreudigen Kultur einen Freifahrtschein auszustellen war verantwortungslos“, kritisierte Rossmanith das BVL.
Dem schob der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Juli einen Riegel vor. Denn er entschied, dass alle mit Verfahren der Mutagenese gewonnenen Pflanzen und Tiere gentechnisch veränderte Organismen (GVO) im Sinne der EU-Freisetzungsrichtlinie sind. Das heißt, sie müssen auf ihr Risiko geprüft, gekennzeichnet und nachverfolgbar sein. Zwar gibt es davon laut Richtlinie auch Ausnahmen. Die gelten laut EuGH aber nur für solche Mutagenese-Verfahren, die bereits länger angewandt wurden und als sicher gelten. Das ist bei der von der Firma CIBUS eingesetzten Oligonukleotid-gesteuerte-Mutagenese (OgM) nicht der Fall.
Die von CIBUS unter dem Namen „Rapid Trait Development System“ (RTDS) verwendete OgM-Technologie verändert das Erbgut mittels kurzer, im Labor synthetisierter DNA-Sequenzen, die in die Zelle eingeführt werden. Wie das Klägerbündnis in seiner Presseinformation ausführt, sollen diese die DNA in der Zelle dazu veranlassen, sich an einer gewünschten Stelle dem fremden Muster anzupassen. Der genaue Mechanismus der Veränderung sei unklar, das habe auch die Zentrale Kommission für Biologische Sicherheit in ihrer Stellungnahme eingeräumt, heißt es weiter.
Ferner monierten die Kläger die fehlende Zuständigkeit des BVL. Die EU-Kommission hatte die EU-Mitgliedstaaten ausdrücklich aufgefordert, die rechtliche Einstufung der neuen Technologien durch die Kommission abzuwarten, da das EU-Kompetenz sei. Dennoch hielt das BVL seinen Bescheid aufrecht. Es stellte ihn allerdings unter den Vorbehalt, ihn nach einer Entscheidung der EU-Kommission zu ändern. Geklagt hatte ein Bündnis aus 17 Verbänden, Initiativen und Unternehmen aus dem Agrar- und Umweltbereich, koordiniert von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Mit der Rücknahme des Bescheids hat sich dann auch die Klage beim Verwaltungsgericht Braunschweig erledigt. [vef]
- BVL-Fachmeldungen: Cibus Raps-Bescheid vom BVL zurückgenommen (17.8.2018)
- AbL e.V. für Klägerbündnis: CIBUS-Raps ist Gentechnik und kommt nicht auf den Acker (20.8.2018)
- Infodienst - Genschere: Darf Raps mit Punktmutation aufs Versuchsfeld? (8.08.2018)
- Infodienst: Cibus-Raps darf vorerst nicht aufs Feld (30.07.2015)
13.08.2018 | permalink
Glyphosat-Urteil: Monsanto soll Krebsopfer 289 Millionen Dollar zahlen

UPDATE +++ Die Geschworenen entschieden einstimmig: Die Bayer-Tochter Monsanto soll einem krebskranken Platzwart, der jahrelang mit dem glyphosathaltigen Spritzmittel Roundup arbeitete, 289 Millionen US-Dollar Schadenersatz zahlen. Monsanto will dagegen Berufung einlegen. Bayer erwartet in den USA etwa 8000 ähnliche Klagen gegen Monsanto. Die Bayer-Aktie brach heute um mehr als zehn Prozent ein.
Wie die Neue Zürcher Zeitung berichtete, befand die Geschworenenjury in San Francisco am Freitag (Ortszeit), Monsanto habe vor den Risiken seiner Unkrautvernichter nicht ausreichend gewarnt. Deren Wirkstoff Glyphosat steht in Verdacht, Krebs zu verursachen. Und weil die Bayer-Tochter das verschleiert habe, müsse das Unternehmen dem Platzwart Dewayne Johnson, der seine Krebserkrankung auf die Arbeit mit glyphosathaltigen Spritzmitteln zurückführt, 39 Millionen Dollar Schmerzensgeld und 250 Millionen Dollar Strafzuschlag zahlen. Der Strafzuschlag wurde fällig, weil die Jury davon ausging, dass Monsanto vorsätzlich gehandelt hat. Damit beträgt der gesamte Schadenersatz im Fall Johnson umgerechnet rund 253 Millionen Euro.
Ob Johnsons Frau und seine Kinder die 289 Millionen Dollar tatsächlich erhalten werden, wird erst nach dem Berufungsurteil feststehen. In der Vergangenheit sind so hohe Schadenersatzsummen von der nächsten Instanz schon deutlich gedrückt worden. Auch die Frage, wie hoch die Ersatzforderungen insgesamt werden, die der Chemiekonzern Bayer sich mit Monsanto im Juni eingekauft hat, lässt sich aktuell schwer abschätzen. Denn dieses Urteil ist eine Einzelfallentscheidung ohne Bindungswirkung. Die Klage des 46jährigen Johnson war vorgezogen worden, da er nach Angaben seiner Ärzte wegen seines Lymphdrüsenkrebses (Non-Hodgkin-Lymphom) bald sterben wird. Trotzdem wird dem Urteil Signalcharakter für die folgenden Prozesse zugeschrieben.
So steht demnächst – ebenfalls in Kalifornien - eine Sammelklage von 450 Krebspatienten an, die den Wirkstoff Glyphosat für ihre Erkrankung verantwortlich machen. Wie der Infodienst berichtete, hatte ein Bundesrichter in San Francisco die Sammelklage Mitte Juli zugelassen. Ein Verfahren vor einer Geschworenen-Jury ist nach Ansicht des Richters jedoch nur dann zu rechtfertigen, wenn die Kläger in einigen Fällen belegen können, dass Glyphosat in den bei der Anwendung üblichen Mengen ein Non-Hodgkin Lymphom verursachen könnte.
Wie die Süddeutsche Zeitung berichtete, behaupteten Vertreter von Bayer und Monsanto, dass hier kein Zusammenhang bestehe. Die Börse reagierte trotzdem: Die Bayer-Aktie fiel nach Informationen des Portals Proplanta auf den tiefsten Stand seit Mai 2016. Laut Handelsblatt verlor der Chemiekonzern damit zehn Milliarden Euro an Börsenwert. Dem solcherart beschädigten Image Bayers wird es wohl wenig nützen, wenn in einigen Tagen der Name Monsanto mit Beginn der Unternehmensintegration verschwinden wird. Denn die Prozesse müssen dann alle im Namen Bayers geführt werden - mit ungewissem Ausgang.
Die Internationale Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht jedenfalls seit 2015 davon aus, dass Glyphosat «wahrscheinlich krebserregend» für den Menschen ist. Und die Grünen fordern schon seit langem, dass nicht nur der reine Wirkstoff Glyphosat, sondern auch die Kombination der Wirkstoffe in den Spritzmitteln auf ihre Gesundheitsrisiken getestet werden müssen. Denn das könnte nochmal neue Gefahrenpotentiale an den Tag bringen. [vef]
- NZZ: Die EU sieht keinen Grund ihre Glyphosat-Praxis zu überdenken (13.8.2018)
- Süddeutsche.de: Glyphosat - Sieg gegen Monsanto (12.8.2018)
- Proplanta: Krebs-Prozess mit hoher Strafe: Folgen des Urteils für Monsanto (13.8.2018)
- Glyphosat: Sammelklage gegen Bayer nimmt die nächste Hürde (12.07.2018)
- Infodienst: Krebs durch Glyphosat? Erster Juryprozess beginnt in den USA (19.06.2018)
25.07.2018 | permalink
Europäischer Gerichtshof: CRISPR ist Gentechnik

Der Europäische Gerichtshof hat in einem lange erwarteten Urteil klar festegestellt: Neue Formen der Gentechnik wie CRISPR-Cas fallen unter die Regulierung gentechnisch veränderter Organismen der EU. Mutagenese-Verfahren, so der Gerichtshof laut seiner Pressemitteilung, seien grundsätzlich gentechnische Verfahren im Sinne der Gentechnikrichtlinie. Deshalb seien bestimmte Formen zufälliger Mutagenese (durch Bestrahlung und chemische Behandlung), die bei Erlaß der Richtlinie bereits seit langem in Gebrauch waren, von der Regulierung explizit ausgenommen worden. Neue, gezielte Formen der Mutagenese etwa durch das CRISPR-Cas Verfahren, fallen dagegen nach seinem Urteil nicht unter diese Ausnahme. Sie seien anderen Gentechnikverfahren vergleichbar und müßten auch im Sinne des Vorsorgeprinzips genauso auf ihre Risiken geprüft, zugelassen und gekennzeichnet werden.
18.04.2018 | permalink
EU-Zulassungsverfahren für Pestizide soll transparenter werden

Die EU-Kommission hat einen Verordnungsvorschlag vorgelegt, der die Transparenz bei der EU-Risikobewertung von Pestiziden, gentechnisch veränderten Organismen (GVO) und Lebensmittelzusätzen verbessern soll. Sie reagierte damit auf eine Forderung der Europäischen Bürgerinitiative Stop Glyphosat, die im vergangenen Jahr von mehr als 1,3 Millionen EU-Bürgern unterstützt worden war.
Ausgangspunkt war der Streit um die Risikobewertung des Herbizidwirkstoffs Glyphosat, bei der sich die EU-Lebensmittelbehörde EFSA auf nichtöffentliche Studien des Herstellers Monsanto gestützt hatte. Hinzu kamen Enthüllungen, die zeigten, dass Arbeiten angeblich neutraler Wissenschaftler von Monsanto finanziert worden waren. Die Bürgerinitiative hatte daraufhin verlangt, dass die wissenschaftliche Bewertung von Pestiziden durch die Regulierungsbehörden der EU „allein auf der Grundlage veröffentlichter Studien erfolgt, die von den zuständigen Behörden und nicht von der Pestizidindustrie in Auftrag gegeben wurden“. Ähnlich hatte das EU-Parlament in einer im Oktober 2017 verabschiedeten Resolution argumentiert: „Das Zulassungsverfahren der EU, einschließlich der wissenschaftlichen Bewertung von Stoffen, sollte sich nur auf veröffentlichte, von Fachleuten geprüfte und unabhängige Studien stützen, die von den zuständigen Behörden in Auftrag gegeben wurden.“
In ihrem Verordnungsvorschlag stellt die Kommission klar, dass die für eine Zulassung notwendigen Studien weiterhin von den Herstellern erstellt werden. Künftig sollen jedoch sämtliche Studien in einem EU-Register veröffentlicht werden. Allerdings dürfen die Hersteller dabei weiterhin Daten, die sie als Geschäftsgeheimnisse definieren, zurückhalten. Die EFSA erhält die Möglichkeit, bei heftigen Kontroversen zusätzliche Studie in Auftrag zu geben, die aus dem EU-Haushalt finanziert werden. Zudem müssen bei Industriestudien künftig interessierte Nichtregierungsorganisationen konsultiert werden. Diese Regelungen sollen nicht nur für Pestizide, sondern auch für andere Risikobewertungen in der Lebensmittelkette gelten, etwa für GVO, Zusatzstoffe, Enzyme oder Verpackungsmaterialien.
„Der Protest von mehr als einer Million europäischer Bürger über die Europäische Bürgerinitiative ‚Stop Glyphosate‘ scheint sich jetzt auszuzahlen“, kommentierte der grüne EU-Parlamentarier Martin Häusling die Vorlage der Kommission. Martin Pigeon, Campaigner für Lebensmittelpolitik bei Corporate Europe Observatory sprach von ersten wichtigen Schritten, wies auf dem Portal Euractiv aber auf einen großen Haken der Regelung hin: „Jeder, der die Daten zitieren und verwenden will, muss die Erlaubnis des Unternehmens einholen, das der EFSA diese Daten zur Verfügung gestellt hat.“ Greenpeace-Sprecher Mark Breddy kritisierte, dass nach wie vor die Hersteller von Pestiziden die Prüfung ihrer eigenen Produkte kontrollieren: „Dies sollte in der Regel Aufgabe der EU sein – nicht nur in kontroversen Fällen.“ Zahlen dafür sollen laut Breddy die Unternehmen, die ihre Produkte zulassen wollen. Die Verbraucherorganisation Foodwatch kritiserte dass die von der EU-Kommission erwogenen Korrekturen insgesamt zu kurz greifen. „Da wird eine Riesenchance vertan“, sagte der Geschäftsführer von Foodwatch International, Thilo Bode.
Die Kommission will ihren Vorschlag nun mit dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten diskutieren und bis Mitte 2019 verabschieden. Parallel dazu arbeitet im Parlament ein Sonderausschuss die Erfahrungen mit der Risikobewertung des Herbizids Glyphosat auf. Dabei nehmen 30 Abgeordnete das Zulassungsverfahren für Pestizide, potenzielle Mängel bei der wissenschaftlichen Bewertung und mögliche Interessenskonflikte unter die Lupe. Sie sollen in neun Monaten einen Abschlussbericht mit Tatsachenfeststellungen und Empfehlungen vorlegen, die sicher auch die Haltung des Parlaments zu dem Vorschlag der Kommission beeinflussen werden. [lf]
- Europäische Kommission: Proposal for a Regulation on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain, 2018/0088 (COD), 11.04.2018
- Europäische Kommission: Factsheet - Vorschlag der Kommission betreffend Transparenz und Nachhaltigkeit des EU-Risikobewertungsmodells in der Lebensmittelkette (11.04.2018)
- Euractiv: Kommission will Vertrauen in Lebensmittelsicherheit stärken – Reaktionen durchwachsen (12.04.2018)
- Greenpeace Europa: EU Commission plan allows chemical producers to keep control of science behind pesticide approvals (11.04.2018)
- Foodwatch: EU-Kommission will Risikobewertung verbessern (12.04.2018)
- Europäisches Parlament: Sonderausschuss zu Pestiziden: Parlament billigt Mitgliederliste (08.02.2018)
18.04.2018 | permalink
Starke UN-Erklärung für die Rechte von Kleinbauern gefordert

Auch dieses Jahr stand der internationale Tag des kleinbäuerlichen Widerstandes am 17. April wieder ganz im Zeichen der Rechte von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Rund um den Globus fanden Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen statt, bei denen Bauernorganisationen und zivilgesellschaftliche Gruppen auf die Probleme von Kleinbauern und Landlosen aufmerksam machten. Während die einen auf die Straße gingen, verhandelte in Genf eine Arbeitsgruppe des UN-Menschenrechtsrats vom 9. bis 13. April eine Erklärung für die Rechte von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten. Seit 2012 wird daran schon gearbeitet und gefeilt, nun ging es in die fünfte und letzte Verhandlungsrunde. Im Juni 2018 soll das Endergebnis dem UN-Menschenrechtsrat zur Annahme vorgelegt werden. Mit der Rolle der EU und Deutschlands in diesem Prozess nicht unbedingt zufrieden zeigte sich ein Bündnis deutscher NGOs, zu dem unter anderem die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), die Menschenrechtsorganisation FIAN Deutschland oder das entwicklungspolitische INKOTA-Netzwerk gehören. Sie werfen der EU und Deutschland vor, die Erklärung zu torpedieren und zu verwässern.
„Leider hat sich die Bundesregierung nicht direkt in die Verhandlungen eingebracht, sondern hat sich von der EU vertreten lassen. Diese brachte vor allem Vorschläge ein, die die Wirkkraft der Erklärung schwächen würden“, kritisiert FIAN-Referentin Gertrud Falk, die die Verhandlungen beobachtete. Die EU weigere sich bisher, grundlegende Rechte von Kleinbauern anzuerkennen, wie zum Beispiel das Recht auf Saatgut, das Recht auf Land oder auf eine gesunde Umwelt, obwohl diese Rechte Voraussetzung für die Verwirklichung anderer Menschenrechte dieser Bevölkerungsgruppe seien. Der bisherige 14 Seiten und 28 Artikel umfassende Textentwurf sieht zum Beispiel in Artikel 21 das Recht auf Wasser vor. Hier etwa wollte die EU erreichen, dass der Titel in „Zugang zu Wasser“ abgeändert wird, um den rechtlichen Aspekt herauszunehmen, berichtet Falk: Das Recht auf Wasser ist viel umfassender als allein der Zugang, sagte sie gegenüber dem Deutschlandfunk: „Es geht dabei darum, dass Kleinbauern und Kleinbäuerinnen und Kleinfischer und Kleinfischerinnen vor allen Dingen natürlich auch ihre Wasserressourcen pflegen dürfen, ihre gemeinschaftlichen Nutzungsweisen daran weiter kultivieren dürfen und ausüben können, und dass Wasserressourcen wie Quellen, aber auch die Seen und Bachläufe nicht privatisiert werden, wie das leider zunehmend der Fall ist, da große Konzerne versuchen, diese Ressourcen zu privatisieren und dann für ihren alleinigen Profit zu nutzen.“
Ebenfalls ein Dorn im Auge seien der EU kollektive Rechte. Doch Kleinbauern leben und arbeiten in vielen Regionen der Welt als Gemeinschaft und pflegen auch die natürlichen Ressourcen gemeinsam. „Rechte werden ihnen oft als Gemeinschaft streitig gemacht und müssen deshalb auch als gemeinschaftliche Rechte geschützt werden“, fordert Falk. Ein weiterer strittiger Punkt ist ein Recht auf Saatgut. Bäuerin Paula Gioia, die für die AbL am Verhandlungstisch saß, erklärte dazu: „Wir Bauern und Bäuerinnen kultivieren seit Jahrtausenden Saatgut und garantieren damit eine Sortenvielfalt, die für nährstoffreiche Nahrungsmittel, biologische Vielfalt und Anpassungen an Klimaveränderungen sorgt.“ Die Agrarindustrie strebe hingegen überall auf der Welt die Vereinheitlichung von Landwirtschaft und Nahrungsmitteln an und übernehme zunehmend die Kontrolle über die landwirtschaftlichen Grundlagen wie Land, Wasser und Saatgut. „Unser Recht auf Ernährungssouveränität muss dagegen geschützt werden“, fordert Gioia. „Dazu braucht es dringend die Unterstützung auch der Bundesregierung und der EU für eine starke UN-Erklärung.“
Rechte auf dem Papier sind das eine und die Umsetzung in der Realität das andere. Dennoch ist Falk überzeugt von der Notwendigkeit des Papiers: „Diese Erklärung fasst bestehendes Völkerrecht, was Kleinbauern betrifft, zusammen und interpretiert es für ihre Bedürfnisse. Das heißt, es stärkt sehr stark das Rechtsbewusstsein, das Menschenrechtsbewusstsein dieser Gruppe, sodass sie wissen, sie können politisch diese Rechte einfordern. Die Rechte werden nicht einklagbar sein, aber die Staaten, die hinterher der Erklärung zustimmen, verpflichten sich damit politisch, diese Rechte auch umzusetzen“, sagte sie dem Deutschlandfunk. (ab)
- INKOTA-netzwerk e.V.: Pressemitteilung Zivilgesellschaftliches Bündnis alarmiert
- Deutschlandfunk: UN-Erklärung der Kleinbauernrechte - "Es geht um das Recht auf Wasser"
- Revised draft United Nations declaration on the rights of peasants and other people working in rural areas
- OHCHR: Fifth session of the open-ended intergovernmental working group on the rights of peasants
15.04.2018 | permalink
Vor 10 Jahren: Weltagrarbericht forderte Kurswechsel in der Landwirtschaft

Vor zehn Jahren am 15. April 2008 war es soweit – der Weltagrarrat verkündete in einer Presseerklärung das Ergebnis seiner vier Jahre andauernden Arbeit: Die Art und Weise, wie die Welt Lebensmittel anbaut, muss sich radikal ändern, damit Armut und Hunger besiegt werden können – nur so kann es gelingen, eine wachsende Weltbevölkerung in Zeiten des Klimawandels zu ernähren und den sozialen und ökologischen Kollaps zu vermeiden. So lautete die Kernbotschaft des International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD), bekannt als Weltagrarbericht. Im Auftrag der Weltbank und der UN hatten über 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Disziplinen und Kontinente den Wissensstand über die globale Landwirtschaft, ihre Geschichte und Zukunft zusammengefasst. Sie befassten sich mit der Frage, wie durch die Schaffung, Verbreitung und Nutzung von landwirtschaftlichem Wissen, Forschung und Technologie Hunger und Armut verringert, ländliche Existenzen verbessert und gerechte, ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Entwicklung gefördert werden kann. Ihre Antwort lieferten sie in einem 600-seitigen globalen Bericht, fünf regionalen Berichten, einem Synthese-Bericht sowie in von Regierungsvertretern auf einer mehrtägigen Sitzung in Johannesburg Absatz für Absatz abgestimmten Zusammenfassungen, die am 11. April 2008 von rund 60 Regierungen angenommen wurden.
Der Bericht konstatiert, dass die industrielle Landwirtschaft die Lebensmittelproduktion erheblich steigern konnte, jedoch nicht alle gleichermaßen davon profitierten: Kleinbauern, Landarbeiter, ländliche Gemeinden und die Umwelt bezahlten dafür einen unzumutbar hohen Preis. „Weiter-wie-bisher ist keine Option – es schadet den Armen, es wir nicht funktionieren“, sagte IAASTD-Direktor Professor Robert Watson 2008. „Wir müssen anerkennen, dass weltweit immer mehr Lebensmittel produziert werden, aber dies nicht allen zugutekam.“ Er warnte vor einem blinden Produktionsstreben: „Ein Weiter-wie-bisher würde bedeuten, dass die Umwelt weiter zerstört wird und Arm und Reich immer stärker auseinanderdriften. Es würde uns eine Welt bescheren, in der keiner mehr leben will.“ Der Bericht forderte daher die Schaffung eines institutionellen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmens, um Produktivität mit der Bewahrung der natürlichen Ressourcen, wie Böden, Wasser, Wälder und Biodiversität, unter einen Hut zu bringen.
Der Weltagrarbericht räumt mit dem Mythos der Überlegenheit industrieller Landwirtschaft aus volkswirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Sicht gründlich auf und unterstreicht die bedeutende Rolle von Kleinbauern für die Welternährung. „Chancen bieten jene kleinbäuerlichen Systeme, die eine hohe Wasser-, Nährstoff- und Energieeffizienz aufweisen und die natürlichen Ressourcen und Biodiversität bewahren, ohne den Ertrag zu opfern“, ist eines der 22 Schlüsselergebnisse der globalen Zusammenfassung. Der Bericht forderte mehr Investitionen für Kleinbauern, um so den Hunger zu bekämpfen. „Das Erzielen von bedeutenden Fortschritten für die Armen erfordert das Eröffnen von Möglichkeiten für Innovation und Unternehmergeist, speziell ausgerichtet auf Bauern und Landarbeiter, denen es an Ressourcen mangelt“, lautet eine weitere Erkenntnis. „Dies erfordert zugleich Investitionen in Infrastruktur sowie die Förderung des Zugangs zu Märkten, Handelsmöglichkeiten, Berufsausbildung, landwirtschaftlichen Beratungsdiensten, Kapital, Krediten, Versicherungen und natürlichen Ressourcen wie Land und Wasser.
Die zivilgesellschaftlichen Gruppen, die am IAASTD-Prozess beteiligt waren, begrüßten die Aussagen des Weltagrarberichts, auch wenn sie nicht mit allen Schlussfolgerungen zufrieden waren, auf die sich die Regierungsvertreter geeinigt hatten. „Heute beginnt eine neue Epoche der Landwirtschaft“ überschrieben sie hoffnungsvoll ihre englische Pressemitteilung vom 15. April 2008. Die NGOs, zu denen z.B. Greenpeace, das Pestizid-Aktionsnetzwerk oder das Third World Network gehörten, nannten den Bericht ein „ernüchternde Abrechnung mit der industriellen Landwirtschaft“, die zu fundamentalen Veränderungen in der Landwirtschaft aufrufe, „um rasant steigenden Preisen, Hunger, sozialer Ungerechtigkeit und ökologischen Desastern Einhalt zu gebieten“. Ein Ausweg aus der Krise in der Landwirtschaft biete „die volle Einbeziehung lokalen und indigenen Wissens, die Stärkung von Frauen, die die Hauptlast landwirtschaftlicher Arbeit in den Entwicklungsländern tragen, und ein Forschungsschwerpunkt auf kleinbäuerliche und agrarökologische Anbaumethoden“. Die NGOs appellierten an Regierungen, internationale Organisationen und die Zivilgesellschaft, die Empfehlungen des Weltagrarberichts rasch umzusetzen. Ein Jahrzehnt ist seither vergangen – es ist also an der Zeit, an die Kernbotschaften dieses einmaligen Prozesses zu erinnern und Bilanz zu ziehen, wie es aktuell um die Umsetzung bestellt ist. (ab)